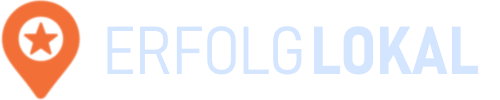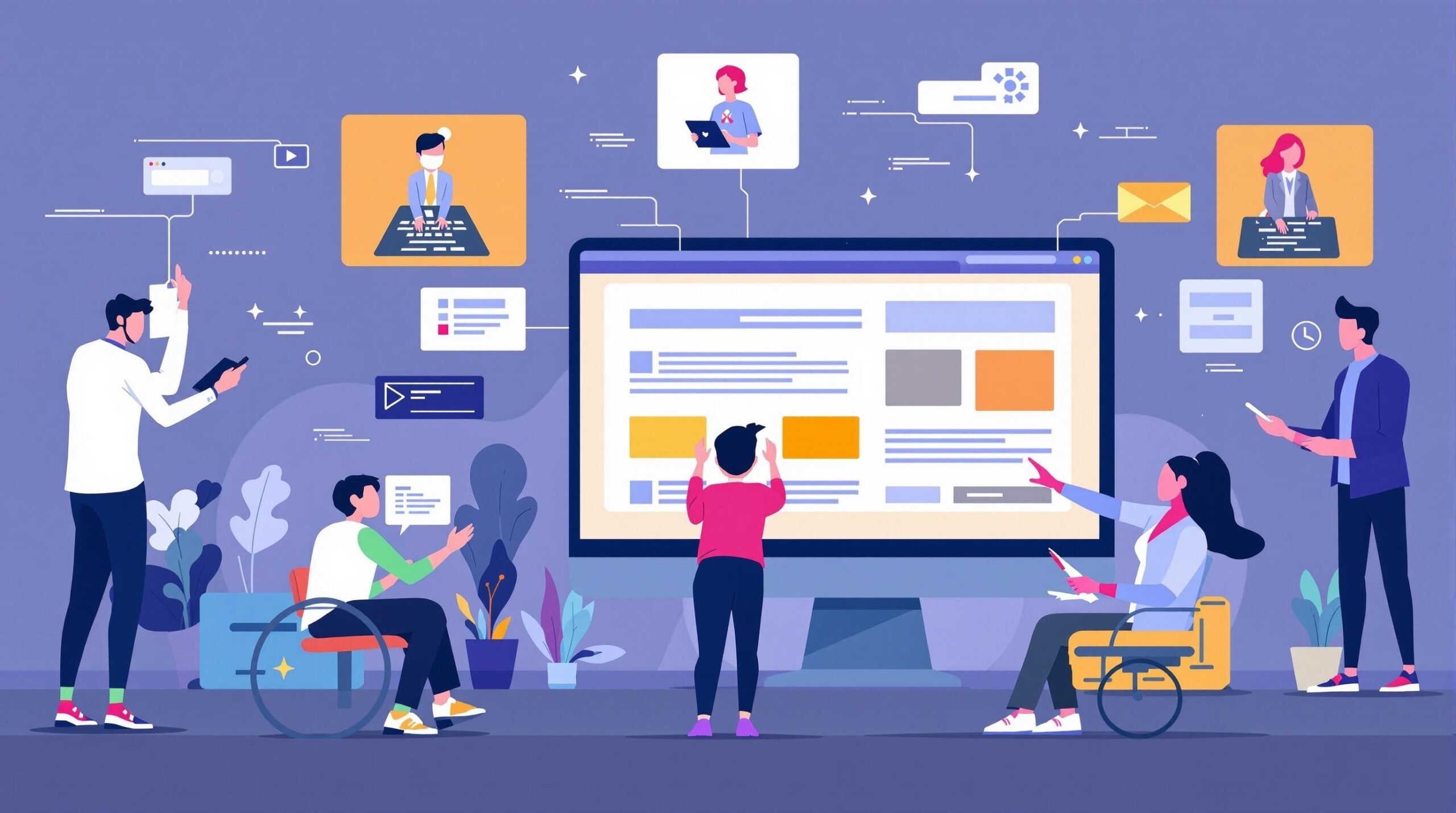- Das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (BFSG) tritt am 28. Juni 2025 in Deutschland in Kraft und macht barrierefreie Webseiten für viele Unternehmen zur rechtlichen Pflicht
- Betroffen sind Online-Shops, E-Commerce-Plattformen, Buchungsportale und Websites bestimmter Branchen wie Banking und Telekommunikation
- Kleinstunternehmen mit weniger als 10 Mitarbeitern und unter 2 Millionen Euro Jahresumsatz sind von der Pflicht ausgenommen
- Die Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 Level AA bilden den technischen Standard mit 50 konkreten Erfolgskriterien
- Verstöße können zu Bußgeldern bis zu 100.000 Euro, Abmahnungen und Website-Sperrungen führen
- Praktische Umsetzung erfordert ausreichende Farbkontraste (mindestens 4,5:1), aussagekräftige Bildbeschreibungen und vollständige Bedienbarkeit mit der Tastatur
- Eine detaillierte Erklärung zur Barrierefreiheit muss prominent auf betroffenen Websites veröffentlicht werden
- Automatisierte Testing-Tools decken nur 30-40% der Probleme auf – manuelle Tests sind unverzichtbar
Die digitale Teilhabe wird 2025 zur rechtlichen Realität: Mit dem Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (BFSG) müssen erstmals auch private Unternehmen ihre Webauftritte barrierefrei gestalten. Was bisher nur für öffentliche Stellen galt, betrifft nun Millionen von Online-Shops, Buchungsplattformen und Unternehmenswebsites. Etwa 7,9 Millionen Menschen in Deutschland leben mit einer Schwerbehinderung – sie alle haben ab dem 28. Juni 2025 einen Rechtsanspruch auf barrierefreie digitale Dienste [1].
Barrierefreiheit bedeutet dabei weit mehr als nur technische Compliance: Es geht darum, Websites so zu gestalten, dass alle Menschen sie nutzen können – unabhängig von ihren körperlichen oder kognitiven Fähigkeiten. Eine blinde Person muss mit einem Screenreader durch Ihre Website navigieren können, jemand mit motorischen Einschränkungen muss alle Funktionen nur mit der Tastatur bedienen können, und Menschen mit Sehschwäche müssen Texte auch bei schlechteren Kontrasten lesen können. Dieser Praxisleitfaden zeigt Ihnen konkret, wie Sie diese Anforderungen erfüllen – ohne technisches Fachchinesisch, sondern mit praktischen Anleitungen für den Alltag.
Inhaltsverzeichnis
Wer muss eine barrierefreie Webseite anbieten? Voraussetzungen und Ausnahmen
- Online-Shops und E-Commerce-Plattformen aller Größenordnungen fallen unter die Regelung
- Buchungsplattformen für Hotels, Reisen, Events und Dienstleistungen sind betroffen
- Banken, Telekommunikationsunternehmen und Verkehrsbetriebe müssen ihre kompletten Webauftritte anpassen
- Kleinstunternehmen unter 10 Mitarbeitern und 2 Mio. Euro Jahresumsatz sind ausgenommen
- Reine B2B-Angebote ohne Verbraucherkontakt unterliegen nicht der Pflicht
Der praktische Selbstcheck: Bin ich betroffen?
Die wichtigste Frage vorab: Verkaufen oder vermitteln Sie etwas über Ihre Website an Privatpersonen? Falls ja, sind Sie höchstwahrscheinlich vom BFSG betroffen. Das Gesetz erfasst alle „Dienstleistungen im elektronischen Geschäftsverkehr“ – ein bewusst weit gefasster Begriff, der mehr umfasst, als viele Unternehmer zunächst denken [2].
Eindeutig betroffene Geschäftsmodelle:
- Online-Shops jeder Art: Ob Sie Schuhe, Bücher oder Maschinenteile verkaufen – entscheidend ist der Online-Verkauf an Endkunden
- Buchungsplattformen: Hotels, Restaurants, Friseure, Ärzte, Beratung – überall wo Kunden online Termine buchen können
- Ticketverkauf: Konzerte, Theater, Veranstaltungen, Nahverkehr
- Download-Portale: Software, E-Books, Musik, Videos
- Abo-Services: Newsletter-Anmeldungen mit kostenpflichtigen Inhalten, Streaming-Dienste
Oft übersehene Bereiche:
- Kontaktformulare mit Angebotsanfrage: Wenn Kunden über Ihre Website individuelle Angebote anfordern können
- Kostenvoranschlag-Tools: Online-Rechner für Versicherungen, Kredite, Handwerksleistungen
- Newsletter mit E-Commerce: Auch kostenlose Newsletter, die zum Kauf führen sollen
- Gutschein-Verkauf: Auch kleine Beträge machen Sie zum Händler
Die Kleinstunternehmen-Ausnahme verstehen
Sie sind von der BFSG-Pflicht befreit, wenn Sie alle drei Kriterien erfüllen:
- Weniger als 10 Vollzeit-Mitarbeiter (Jahresarbeitseinheiten)
- Teilzeitkräfte werden anteilig gerechnet
- Beispiel: 5 Vollzeit + 6 Halbzeit = 8 JAE ✅
- Auszubildende und Elternzeit zählen nicht mit
- Jahresumsatz unter 2 Millionen Euro ODER Bilanzsumme unter 2 Millionen Euro
- Es reicht, wenn einer der beiden Werte unter 2 Mio. liegt
- Bezugsjahr ist das letzte abgeschlossene Geschäftsjahr
- Dienstleistungsbereich: Die Ausnahme gilt nur für digitale Dienstleistungen, nicht für Produkte
- Verkaufen Sie physische Produkte, die unter das BFSG fallen, müssen diese barrierefrei sein
Achtung bei Franchise und Konzernen: Die Größe wird auf Unternehmensebene gemessen, nicht auf Filialebene.
Branchen mit Sonderregelungen
Vollständig betroffene Branchen (kompletter Webauftritt muss barrierefrei sein):
- Banken und Finanzdienstleister: Online-Banking, Kreditanträge, Versicherungsportale
- Telekommunikation: Mobilfunk, Internet, Festnetz – alle Kundenportale und Services
- Personenbeförderung: Airlines, Deutsche Bahn, Fernbusse, Schifffahrt
- Ausnahme: Lokaler Nahverkehr (Stadtwerke, Verkehrsverbünde)
Grenzfälle richtig einschätzen:
✅ Friseur mit Online-Terminbuchung → BFSG-pflichtig
✅ Anwaltskanzlei mit Mandanten-Portal → BFSG-pflichtig
✅ Immobilienmakler mit Besichtigungsterminen → BFSG-pflichtig
❌ Reine Informationswebsite ohne Buchungsfunktion → Nicht betroffen
❌ B2B-Portal nur für Geschäftskunden → Nicht betroffen
❌ Vereinswebsite ohne kommerzielle Angebote → Nicht betroffen
Konsequenzen bei Nicht-Einhaltung
Bußgelder und behördliche Maßnahmen:
- Bis zu 100.000 Euro Bußgeld bei schwerwiegenden Verstößen
- Marktüberwachungsbehörden der Länder führen Kontrollen durch
- Website-Sperrung als ultima ratio möglich
- Zwangsgeld bei wiederholten Verstößen
Wettbewerbsrechtliche Risiken: BFSG-Verstöße gelten als wettbewerbswidrig. Das bedeutet:
- Mitbewerber können Sie kostenpflichtig abmahnen
- Unterlassungserklärungen mit Vertragsstrafen drohen
- Schadensersatzforderungen sind möglich
- Behindertenverbände haben Verbandsklagerecht
Reputationsschäden:
- Negative Presse bei bekannt gewordenen Barrieren
- Social Media Shitstorms schaden der Marke nachhaltig
- Kundenverlust in der zunehmend sensibilisierten Gesellschaft
Die wichtigsten Barrierefreiheits-Prinzipien verstehen
- Wahrnehmbarkeit: Alle Inhalte müssen für jeden Nutzer erkennbar sein
- Bedienbarkeit: Jede Funktion muss auf verschiedene Weise auslösbar sein
- Verständlichkeit: Sprache und Bedienung müssen nachvollziehbar sein
- Robustheit: Die Website muss mit verschiedenen Hilfstechnologien funktionieren
- WCAG 2.1 Level AA definiert 50 konkrete Erfolgskriterien für diese Prinzipien
Wahrnehmbarkeit: Inhalte für alle erkennbar machen
Das Problem verstehen: Nicht jeder kann Ihre Website auf die gleiche Weise wahrnehmen. Blinde Menschen „sehen“ mit dem Screenreader, Gehörlose „hören“ mit den Augen, und Menschen mit Sehschwäche benötigen stärkere Kontraste oder größere Schriften.
Was Wahrnehmbarkeit konkret bedeutet:
Bilder brauchen Beschreibungen (Alt-Texte): Stellen Sie sich vor, Sie beschreiben Ihre Website am Telefon. Was würden Sie zu jedem Bild sagen? Ein Alt-Text ist genau das – eine kurze, prägnante Beschreibung dessen, was auf dem Bild zu sehen ist und warum es wichtig ist.
- Produktbilder: „Rote Nike-Laufschuhe Modell Air Max, Seitenansicht“
- Schaubilder: „Umsatzentwicklung 2024: Anstieg von 2,3 auf 4,1 Millionen Euro“
- Buttons mit Symbolen: „Menü öffnen“ (nicht „Hamburger-Icon“)
- Rein dekorative Bilder: Bleiben ohne Beschreibung
Videos brauchen Untertitel: Gehörlose Menschen können gesprochenen Text nicht hören. Untertitel übersetzen nicht nur Sprache, sondern auch wichtige Geräusche wie „Telefonklingeln“ oder „Applaus“. YouTube erstellt automatische Untertitel, die Sie nur noch korrigieren müssen.
Farben reichen nicht aus: „Klicken Sie auf den roten Button“ funktioniert nicht für farbenblinde Menschen. Zusätzliche Kennzeichnungen wie Symbole, Unterstreichungen oder Beschriftungen sind nötig. Fehlermeldungen in Formularen sollten nicht nur rot eingefärbt sein, sondern auch ein Warnsymbol oder den Text „Fehler:“ enthalten.
Bedienbarkeit: Funktionen für alle zugänglich machen
Das Problem verstehen: Nicht jeder kann eine Maus benutzen. Menschen mit motorischen Einschränkungen, Blinde mit Screenreadern oder Menschen mit Tremor sind auf die Tastatursteuerung angewiesen.
Was Bedienbarkeit konkret bedeutet:
Alles muss mit der Tastatur funktionieren: Drücken Sie die Tab-Taste und navigieren Sie durch Ihre Website. Erreichen Sie jeden Link, jeden Button, jedes Eingabefeld? Können Sie das Hauptmenü öffnen und wieder schließen? Falls nicht, haben Sie ein Accessibility-Problem.
- Tab-Taste: Springt zum nächsten interaktiven Element
- Shift + Tab: Springt zum vorherigen Element
- Enter: Aktiviert Links und Buttons
- Leertaste: Aktiviert Buttons und Checkboxen
- Pfeiltasten: Navigiert in Dropdown-Menüs und Listen
Fokus muss sichtbar sein: Wenn Sie mit Tab durch die Seite springen, muss erkennbar sein, welches Element gerade aktiv ist. Ein dünner blauer Rahmen oder eine farbige Hinterlegung zeigt an: „Hier bin ich gerade“. Viele Designer entfernen diese Fokusmarkierung aus optischen Gründen – das ist ein schwerer Accessibility-Fehler.
Keine Zeitlimits oder Warnung: Automatische Weiterleitungen oder Session-Timeouts können Menschen mit Behinderungen Probleme bereiten. Wenn Zeitlimits nötig sind, müssen Nutzer gewarnt werden und die Möglichkeit haben, die Zeit zu verlängern.
Verständlichkeit: Einfach und nachvollziehbar gestalten
Das Problem verstehen: Komplizierte Sprache, unlogische Navigation oder unklare Fehlermeldungen überfordern nicht nur Menschen mit kognitiven Einschränkungen, sondern auch gestresste Nutzer oder Nicht-Muttersprachler.
Was Verständlichkeit konkret bedeutet:
Einfache Sprache verwenden:
- Kurze Sätze statt Bandwurmsätze
- Bekannte Wörter statt Fachbegriffe
- Aktive Sprache: „Klicken Sie hier“ statt „Hier kann geklickt werden“
- Logische Struktur: Wichtiges zuerst, Details danach
Navigation muss einheitlich sein: Das Hauptmenü sollte auf jeder Seite an der gleichen Stelle stehen. Buttons für ähnliche Funktionen sollten gleich aussehen und gleich beschriftet sein. „Weiter“, „Fortfahren“ und „Nächster Schritt“ verwirren – entscheiden Sie sich für einen Begriff.
Fehlermeldungen müssen helfen: „Eingabe ungültig“ hilft nicht weiter. Besser: „Die E-Mail-Adresse muss ein @-Zeichen enthalten“ oder „Das Passwort muss mindestens 8 Zeichen haben“. Zeigen Sie nicht nur was falsch ist, sondern auch wie es richtig geht.
Robustheit: Mit allen Hilfsmitteln funktionieren
Das Problem verstehen: Menschen mit Behinderungen nutzen verschiedene Hilfstechnologien: Screenreader, Vergrößerungssoftware, Sprachsteuerung oder alternative Tastaturen. Ihre Website muss mit all diesen Geräten funktionieren.
Was Robustheit konkret bedeutet:
Sauberer Code ist Grundvoraussetzung: HTML-Tags müssen korrekt verwendet werden. Eine Überschrift gehört in ein <h1>-Tag, nicht in einen fett formatierten Absatz. Ein Button gehört in ein <button>-Tag, nicht in einen klickbaren <div>. Hilfstechnologien verstehen nur semantisch korrekten Code.
Responsive Design für alle Geräte: Ihre Website muss auf Smartphones, Tablets und Desktop-Computern funktionieren. Aber auch bei starker Vergrößerung: Wenn jemand die Schrift auf 200% vergrößert, darf die Navigation nicht verschwinden oder unbrauchbar werden.
Farbkontraste richtig messen und optimieren
- Normale Schrift braucht mindestens 4,5:1 Kontrast zum Hintergrund
- Große Schrift (ab 18pt) braucht mindestens 3:1 Kontrast
- Buttons und Bedienelemente brauchen 3:1 Kontrast
- Kostenlose Tools messen Kontraste automatisch
- Gute Kontraste helfen allen Nutzern, nicht nur Menschen mit Sehbehinderung
Das Problem: Viele moderne Websites setzen auf helle, dezente Farben – grauer Text auf weißem Hintergrund sieht elegant aus. Für Menschen mit Sehschwäche, Grauem Star oder bei ungünstigen Lichtverhältnissen (Sonnenschein auf dem Handy-Display) wird solcher Text aber unleserlich.
Wer profitiert von guten Kontrasten:
- Menschen mit Sehbehinderungen oder Farbenblindheit
- Ältere Menschen mit nachlassender Sehkraft
- Alle Nutzer bei hellem Sonnenlicht oder schlechten Bildschirmen
- Menschen mit Migräne oder Augenermüdung
Die WCAG-Kontrastregeln verstehen
Level AA (Mindeststandard für BFSG):
- Normaler Text: Mindestens 4,5:1 Kontrast
- Großer Text (ab 18pt normal oder 14pt fett): Mindestens 3:1 Kontrast
- Grafiken und Bedienelemente: Mindestens 3:1 Kontrast
Was bedeuten diese Zahlen? Das Kontrastverhältnis misst den Helligkeitsunterschied zwischen zwei Farben. 1:1 bedeutet „gar kein Kontrast“ (weiß auf weiß), 21:1 ist maximaler Kontrast (schwarz auf weiß).
Kontraste praktisch messen
Methode 1: Browser-Entwicklertools (Chrome)
- Rechtsklick auf den Text → „Untersuchen“
- Im Styles-Tab auf den Farbwert klicken
- Der Kontrast-Indikator zeigt sofort:
- ✅ Grüner Haken: AA erfüllt (4,5:1 erreicht)
- ⚠️ Oranges Dreieck: Nur AAA erfüllt (7:1 erreicht)
- ❌ Rotes X: Nicht bestanden
Methode 2: WebAIM Contrast Checker (kostenlos online)
- Öffnen Sie https://webaim.org/resources/contrastchecker/
- Vordergrundfarbe eingeben (Textfarbe)
- Hintergrundfarbe eingeben
- Sofortiges Ergebnis mit Pass/Fail für AA und AAA
Methode 3: Colour Contrast Analyser (Desktop-App)
- Kostenlose Software von Paciello Group
- Pipette-Tool zum direkten Messen am Bildschirm
- Echtzeit-Kontrolle während des Designs
Häufige Kontrastfehler und Lösungen
Fehler 1: Hellgrauer Text auf weißem Hintergrund
❌ Schlecht: #999999 auf #ffffff (2,8:1)
✅ Besser: #666666 auf #ffffff (5,7:1)
✅ Noch besser: #333333 auf #ffffff (12,6:1)
Fehler 2: Dünne Schrift mit zu wenig Kontrast Dünne Schriftarten brauchen stärkere Kontraste als dicke. Die Google-Schrift „Roboto Light“ braucht mindestens 5:1 statt 4,5:1.
Fehler 3: Links im Fließtext Links müssen sich deutlich vom normalen Text unterscheiden – nicht nur durch Farbe, sondern auch durch:
- Unterstreichung (klassisch und sicher)
- Fettung (bei deutlichem Farbunterschied)
- Rahmen oder Hintergrund (modern)
Fehler 4: Placeholder-Text in Formularen Der graue Placeholder-Text „Name eingeben…“ ist oft zu hell. Verwenden Sie Labels statt Placeholders oder machen Sie Placeholders dunkler.
Sichere Farbkombinationen für den Alltag
Dunkler Text auf hellem Hintergrund:
Schwarz auf Weiß: #000000 auf #ffffff (21:1) ✅✅✅
Dunkelgrau auf Weiß: #333333 auf #ffffff (12,6:1) ✅✅
Mittelgrau auf Weiß: #666666 auf #ffffff (5,7:1) ✅
Hellgrau auf Weiß: #999999 auf #ffffff (2,8:1) ❌
Heller Text auf dunklem Hintergrund:
Weiß auf Schwarz: #ffffff auf #000000 (21:1) ✅✅✅
Weiß auf Dunkelblau: #ffffff auf #003366 (12,3:1) ✅✅
Hellgrau auf Dunkelgrau: #cccccc auf #333333 (9,5:1) ✅✅
Farbige Kombinationen:
Dunkelblau auf Weiß: #003d82 auf #ffffff (8,2:1) ✅✅
Dunkelgrün auf Weiß: #0f5132 auf #ffffff (9,7:1) ✅✅
Dunkelrot auf Weiß: #842029 auf #ffffff (9,4:1) ✅✅
Praktische Tipps für Designer
Tipp 1: Kontraste von Anfang an mitdenken Prüfen Sie Kontraste bereits beim Erstellen der Farbpalette, nicht erst am Ende. Definieren Sie für jede Hauptfarbe eine dunkle Variante für Text.
Tipp 2: Corporate Design anpassen Falls Ihre Markenfarben zu hell sind, definieren Sie Accessibility-Varianten: Ein hellblaues Logo kann als dunkleres Blau für Texte verwendet werden.
Tipp 3: Automatische Prüfung einbauen Verwenden Sie Design-Tools mit Kontrast-Plugins: Figma, Sketch und Adobe XD haben Erweiterungen, die Kontraste automatisch prüfen.
Tipp 4: Bei Unsicherheit übertreiben Lieber zu starke Kontraste als zu schwache. Was auf dem hochauflösenden Designer-Monitor gut aussieht, kann auf einem alten Smartphone-Display unleserlich werden.
Bilder und Medien barrierefrei gestalten
- Jedes informative Bild braucht einen beschreibenden Alt-Text
- Dekorative Bilder bleiben ohne Beschreibung
- Videos benötigen Untertitel für gesprochene Inhalte
- Komplexe Grafiken brauchen ausführliche Beschreibungen
- Icons und Symbole müssen ihre Funktion erklären
Alt-Texte verstehen und richtig schreiben
Was ist ein Alt-Text? Ein Alt-Text (Alternativtext) ist eine unsichtbare Beschreibung eines Bildes, die Screenreader vorlesen. Stellen Sie sich vor, Sie beschreiben das Bild am Telefon – genau das ist ein guter Alt-Text.
Wann brauche ich Alt-Texte?
- Immer bei informativen Bildern (Produkte, Diagramme, Screenshots)
- Immer bei funktionalen Bildern (Buttons, Links, Icons)
- Nie bei rein dekorativen Bildern (Hintergrundmuster, Rahmen)
Alt-Texte für verschiedene Bildtypen
Produktbilder:
❌ Schlecht: "Schuh" oder "product_image_42.jpg"
✅ Gut: "Nike Air Max Sneaker in rot, Seitenansicht"
✅ Noch besser: "Nike Air Max 270 Herren-Laufschuh in rot, Größe 42"
Personen und Portraits:
❌ Schlecht: "Mann" oder "Geschäftsführer"
✅ Gut: "Max Mustermann, Geschäftsführer, lächelt in die Kamera"
✅ Im Kontext: "Max Mustermann erklärt die neue Produktlinie"
Diagramme und Statistiken:
❌ Schlecht: "Diagramm" oder "Statistik"
✅ Gut: "Balkendiagramm: Umsatzentwicklung 2024 zeigt Anstieg von 2,3 auf 4,1 Millionen Euro"
✅ Komplex: Zusätzlich eine Tabelle mit allen Werten bereitstellen
Icons und Symbole:
❌ Schlecht: "Icon" oder "Symbol"
✅ Gut: "Menü öffnen" (für Hamburger-Icon)
✅ Gut: "Als Favorit speichern" (für Herz-Symbol)
✅ Gut: "Warenkorb (3 Artikel)" (für Shopping-Cart)
Häufige Alt-Text-Fehler vermeiden
Fehler 1: Zu technische Beschreibungen
❌ "Screenshot des Admin-Panels mit User-Management-Interface"
✅ "Verwaltungsbereich zeigt Liste aller registrierten Nutzer"
Fehler 2: Überflüssige Wörter
❌ "Bild zeigt einen roten Ferrari"
✅ "Roter Ferrari 488 GTB vor Firmengebäude"
Fehler 3: Zu lange Beschreibungen Alt-Texte sollten maximal 125 Zeichen haben. Längere Beschreibungen gehören in den normalen Text oder eine separate Bildbeschreibung.
Fehler 4: Doppelte Informationen Wenn der Bildinhalt bereits im umgebenden Text steht, kann der Alt-Text kürzer sein oder ganz entfallen.
Dekorative Bilder richtig markieren
Was sind dekorative Bilder?
- Hintergrundmuster und Texturen
- Rahmen und Linien zur optischen Trennung
- Stockfotos ohne inhaltlichen Bezug
- Wiederholte Icons zur Auflockerung
Wie markiere ich sie? Dekorative Bilder bekommen ein leeres Alt-Attribut: alt="". Das sagt dem Screenreader: „Dieses Bild kannst du ignorieren.“
Videos barrierefrei machen
Untertitel sind Pflicht für:
- Alle gesprochenen Inhalte (Dialoge, Voice-Over, Interviews)
- Wichtige Geräusche (Telefonklingeln, Applaus, Schritte)
- Musik mit relevanten Textinhalten
Untertitel erstellen:
- YouTube automatisch: Lädt automatische Untertitel, die Sie korrigieren können
- Professional: Services wie Rev.com oder GoTranscript für wichtige Videos
- Kostenlos: Tools wie Otter.ai oder Google Docs Spracheingabe
Audiodeskription für wichtige Videos: Bei komplexen visuellen Inhalten (Tutorials, Präsentationen) zusätzliche Sprachbeschreibung der visuellen Elemente in Sprechpausen.
Komplexe Grafiken zugänglich machen
Was sind komplexe Grafiken?
- Organigramme und Flussdiagramme
- Infografiken mit vielen Datenpunkten
- Landkarten mit markierten Standorten
- Technische Zeichnungen und Pläne
Lösungsansätze:
- Kurzer Alt-Text + ausführliche Beschreibung im Text darunter
- Datentabelle als Alternative zu Diagrammen
- Strukturierte Liste statt komplexer Infografik
- Interaktive Version mit fokussierbaren Bereichen
Beispiel Organigramm:
Alt-Text: "Unternehmensstruktur mit Geschäftsführung und 5 Abteilungen"
Beschreibung darunter:
- Geschäftsführung: Max Mustermann (CEO)
- Marketing: 15 Mitarbeiter, Leitung: Anna Schmidt
- Vertrieb: 12 Mitarbeiter, Leitung: Tom Weber
- IT: 8 Mitarbeiter, Leitung: Lisa Chen
- Personal: 4 Mitarbeiter, Leitung: Klaus Meyer
- Finanzen: 6 Mitarbeiter, Leitung: Sarah Johnson
Navigation und Seitenstruktur optimieren
- Klare Überschriftenhierarchie hilft bei der Orientierung
- Sprunglinks ermöglichen schnelle Navigation
- Breadcrumbs zeigen den aktuellen Standort
- Suchfunktionen müssen auffindbar und bedienbar sein
- Menüs müssen mit Tastatur und Screenreader funktionieren
Überschriften richtig strukturieren
Warum sind Überschriften so wichtig? Screenreader-Nutzer navigieren hauptsächlich über Überschriften. Sie können sich alle Überschriften einer Seite auflisten lassen und direkt zu interessanten Abschnitten springen. Eine chaotische Überschriftenstruktur ist wie ein Buch ohne Inhaltsverzeichnis.
Die Überschriften-Hierarchie verstehen:
- H1: Nur einmal pro Seite – der Haupttitel
- H2: Hauptabschnitte der Seite
- H3: Unterabschnitte von H2
- H4-H6: Weitere Untergliederungen
Häufige Fehler bei Überschriften:
❌ Falsch: Überschriften nach Optik wählen
<h1>Haupttitel</h1>
<h3>Wichtiger Abschnitt</h3> <!-- H2 übersprungen -->
<h2>Unterabschnitt</h2> <!-- Hierarchie durcheinander -->
✅ Richtig: Logische Reihenfolge
<h1>Online-Shop für Sportartikel</h1>
<h2>Laufschuhe</h2>
<h3>Nike Air Max</h3>
<h3>Adidas Ultraboost</h3>
<h2>Sportbekleidung</h2>
<h3>Laufshirts</h3>
<h3>Sporthosen</h3>
Praktische Tipps:
- Überschriften müssen aussagekräftig sein: „Details“ ist schlecht, „Technische Daten“ ist besser
- Nicht überspringen: Nach H2 kommt H3, nicht H4
- Optik über CSS steuern: Wenn H3 größer aussehen soll als H2, ändern Sie das CSS, nicht das HTML
Sprunglinks für schnelle Navigation
Was sind Sprunglinks? Versteckte Links am Seitenanfang, die zu wichtigen Bereichen springen. Sie werden nur sichtbar, wenn man sie mit der Tab-Taste ansteuert.
Warum sind sie wichtig? Tastaturnutzer müssen sonst durch das gesamte Hauptmenü tabben, bevor sie zum Inhalt gelangen. Das kann bei komplexen Menüs 50+ Tab-Drücke bedeuten.
Standard-Sprunglinks:
- „Zum Hauptinhalt springen“
- „Zur Navigation springen“
- „Zur Suche springen“
- „Zum Footer springen“
Wie man sie testet:
- Website laden
- Tab-Taste drücken
- Erster Link sollte „Zum Hauptinhalt springen“ sein
- Enter drücken – Sie sollten zum Hauptinhalt springen
Breadcrumbs richtig implementieren
Was sind Breadcrumbs? Die „Brotkrümel-Navigation“ zeigt den Pfad zur aktuellen Seite: Start > Kategorie > Unterkategorie > Aktuelle Seite
Warum wichtig für Accessibility?
- Orientierung besonders für Menschen mit kognitiven Einschränkungen
- Alternative Navigation wenn das Hauptmenü unübersichtlich ist
- Kontext verstehen, besonders bei Deep-Links von Suchmaschinen
Barrierefreie Breadcrumbs:
<nav aria-label="Breadcrumb">
<ol>
<li><a href="/">Startseite</a></li>
<li><a href="/elektronik">Elektronik</a></li>
<li><a href="/elektronik/smartphones">Smartphones</a></li>
<li aria-current="page">iPhone 15 Pro</li>
</ol>
</nav>
Wichtige Details:
aria-label="Breadcrumb"kennzeichnet die Navigationaria-current="page"markiert die aktuelle Seite- Keine Links auf der aktuellen Seite
- Trennzeichen (>, /) nur über CSS, nicht im HTML
Suchfunktionen zugänglich gestalten
Warum ist Suche so wichtig? Für Menschen mit kognitiven Einschränkungen oder Orientierungsproblemen ist die Suche oft der einfachste Weg, Inhalte zu finden.
Barrierefreie Suchfelder:
<div role="search">
<label for="search-input">Suchbegriff eingeben</label>
<input type="search"
id="search-input"
name="search"
placeholder="Produkt suchen..."
aria-describedby="search-help">
<button type="submit">Suchen</button>
<div id="search-help">
Geben Sie mindestens 3 Buchstaben ein
</div>
</div>
Wichtige Anforderungen:
- Label auch bei Placeholder-Text
role="search"kennzeichnet Suchbereiche- Submit-Button muss beschriftet sein
- Hilfetexte für komplexe Suchfunktionen
Autocomplete und Vorschläge:
- Tastaturbedienbar: Pfeiltasten zum Navigieren, Enter zum Auswählen
- Screenreader-Ansagen: Anzahl der Vorschläge ansagen
- Escape-Taste: Schließt Vorschläge
Hauptmenüs barrierefrei entwickeln
Das Problem: Viele moderne Menüs funktionieren nur mit der Maus. Dropdown-Menüs, Mega-Menüs und Mobile Burger-Menüs sind oft unzugänglich für Tastaturnutzer.
Grundregeln für barrierefreie Menüs:
- Alle Menüpunkte müssen mit Tab erreichbar sein
- Untermenüs öffnen sich bei Fokus oder Enter
- Escape-Taste schließt Untermenüs
- Pfeiltasten navigieren in Untermenüs
- Visueller Fokus muss sichtbar sein
Mobile Menüs (Hamburger-Menu):
<button aria-expanded="false"
aria-controls="main-menu"
aria-label="Hauptmenü öffnen">
☰
</button>
<nav id="main-menu" aria-hidden="true">
<ul>
<li><a href="/">Startseite</a></li>
<li><a href="/produkte">Produkte</a></li>
<li><a href="/kontakt">Kontakt</a></li>
</ul>
</nav>
Wichtige ARIA-Attribute:
aria-expanded="true/false"zeigt, ob Menü geöffnet istaria-controlsverbindet Button mit Menüaria-hiddenversteckt geschlossene Menüs vor Screenreadern
Formulare benutzerfreundlich und barrierefrei gestalten
- Jedes Eingabefeld braucht ein eindeutiges Label
- Pflichtfelder müssen klar gekennzeichnet sein
- Fehlermeldungen müssen konkret und hilfreich sein
- Gruppierte Felder gehören in Fieldsets
- Autocomplete-Attribute helfen beim automatischen Ausfüllen
Labels – die Beschriftung von Eingabefeldern
Was sind Labels? Labels sind die Beschriftungen von Eingabefeldern – „Name“, „E-Mail“, „Passwort“. Für Screenreader sind sie essentiell, um zu verstehen, was in ein Feld eingegeben werden soll.
Häufiger Fehler: Nur Placeholder verwenden
❌ Schlecht: Nur Placeholder
<input type="text" placeholder="Ihr Name">
✅ Besser: Label + Placeholder
<label for="name">Name</label>
<input type="text" id="name" placeholder="z.B. Max Mustermann">
Warum Labels wichtig sind:
- Screenreader lesen sie vor: „Name, Eingabefeld“
- Klickbare Fläche wird größer (Label anklicken fokussiert das Feld)
- Placeholder verschwinden beim Tippen, Labels bleiben
Pflichtfelder richtig kennzeichnen
Das Problem: „Rote Sterne“ neben Pflichtfeldern sind nicht barrierefrei, da sie nur über Farbe kommunizieren.
Barrierefreie Pflichtfeld-Kennzeichnung:
<label for="email" class="required">
E-Mail-Adresse
<span aria-label="Pflichtfeld">*</span>
</label>
<input type="email" id="email" required>
Alternative Methoden:
- (Pflichtfeld) hinter dem Label-Text
- required im Label-Text: „E-Mail-Adresse (erforderlich)“
- Autocomplete-Attribute für automatisches Ausfüllen
Wichtig: Erklären Sie am Formularanfang: „Felder mit * sind Pflichtfelder“
Fehlermeldungen die wirklich helfen
Schlechte Fehlermeldungen:
❌ "Eingabe ungültig"
❌ "Fehler"
❌ "Bitte korrigieren"
Gute Fehlermeldungen:
✅ "Die E-Mail-Adresse muss ein @-Zeichen enthalten"
✅ "Das Passwort muss mindestens 8 Zeichen haben"
✅ "Bitte wählen Sie eine Anrede aus"
Fehlermeldungen technisch korrekt einbinden:
<label for="password">Passwort</label>
<input type="password"
id="password"
aria-describedby="password-error"
aria-invalid="true">
<div id="password-error" role="alert">
Das Passwort muss mindestens 8 Zeichen haben
</div>
Wichtige Attribute:
aria-invalid="true"markiert fehlerhafte Felderrole="alert"sorgt für sofortige Screenreader-Ansagearia-describedbyverbindet Feld mit Fehlermeldung
Zusammengehörige Felder gruppieren
Fieldsets für Gruppierungen: Verwandte Eingabefelder gehören in <fieldset>-Gruppen mit beschreibenden <legend>-Überschriften.
Beispiele für Gruppierungen:
- Persönliche Daten: Name, Vorname, Geburtsdatum
- Adresse: Straße, PLZ, Ort
- Anrede: Radio-Buttons für Herr/Frau/Divers
- Zahlungsdaten: Kreditkartennummer, Gültigkeit, CVC
Korrekte Fieldset-Verwendung:
<fieldset>
<legend>Lieferadresse</legend>
<label for="street">Straße und Hausnummer</label>
<input type="text" id="street" autocomplete="street-address">
<label for="zip">Postleitzahl</label>
<input type="text" id="zip" autocomplete="postal-code">
<label for="city">Ort</label>
<input type="text" id="city" autocomplete="address-level2">
</fieldset>
Radio-Buttons und Checkboxes barrierefrei
Radio-Button-Gruppen:
<fieldset>
<legend>Anrede</legend>
<input type="radio" id="mr" name="title" value="mr">
<label for="mr">Herr</label>
<input type="radio" id="mrs" name="title" value="mrs">
<label for="mrs">Frau</label>
<input type="radio" id="diverse" name="title" value="diverse">
<label for="diverse">Divers</label>
</fieldset>
Checkboxes für Zustimmungen:
<input type="checkbox" id="newsletter" name="newsletter">
<label for="newsletter">
Ich möchte den Newsletter erhalten
</label>
<input type="checkbox" id="privacy" name="privacy" required>
<label for="privacy">
Ich stimme der <a href="/datenschutz">Datenschutzerklärung</a> zu
</label>
Navigation in Gruppen:
- Tab: Zur nächsten Gruppe
- Pfeiltasten: Zwischen Radio-Buttons in einer Gruppe
- Leertaste: Checkbox an/aus
Autocomplete für bessere Usability
Autocomplete-Attribute helfen Browsern und Hilfstechnologien beim automatischen Ausfüllen und reduzieren Tippfehler.
Wichtige Autocomplete-Werte:
<input type="text" autocomplete="given-name"> <!-- Vorname -->
<input type="text" autocomplete="family-name"> <!-- Nachname -->
<input type="email" autocomplete="email"> <!-- E-Mail -->
<input type="tel" autocomplete="tel"> <!-- Telefon -->
<input type="text" autocomplete="street-address"> <!-- Straße -->
<input type="text" autocomplete="postal-code"> <!-- PLZ -->
<input type="text" autocomplete="address-level2"> <!-- Stadt -->
<input type="text" autocomplete="country"> <!-- Land -->
Vorteile:
- Schnelleres Ausfüllen für alle Nutzer
- Weniger Tippfehler bei Adressen und E-Mails
- Bessere Unterstützung für Menschen mit motorischen Einschränkungen
- WCAG 2.1 Anforderung 1.3.5 „Identify Input Purpose“
Tastaturnavigation und Bedienbarkeit
- Alle Funktionen müssen ohne Maus bedienbar sein
- Die Tab-Reihenfolge muss logisch und nachvollziehbar sein
- Der Fokus muss immer sichtbar sein
- Tastaturkürzel dürfen andere Hilfstechnologien nicht stören
- Modale Dialoge müssen den Fokus einfangen
Die Tab-Navigation verstehen
Was ist Tab-Navigation? Mit der Tab-Taste springen Nutzer zwischen interaktiven Elementen (Links, Buttons, Eingafelder). Das ist die Hauptnavigationsmethode für Menschen, die keine Maus benutzen können.
Welche Elemente sind fokussierbar?
- Links (
<a href="">) - Buttons (
<button>) - Eingabefelder (
<input>,<textarea>,<select>) - Elemente mit tabindex=“0″
Welche Elemente sind NICHT fokussierbar?
- Überschriften (
<h1>,<h2>, etc.) - Normale Absätze (
<p>) - Bilder (
<img>) - Divs und Spans (außer mit tabindex)
Tab-Reihenfolge logisch gestalten
Die natürliche Tab-Reihenfolge folgt der HTML-Struktur: von oben nach unten, von links nach rechts. In den meisten Fällen ist das richtig.
Typische Tab-Reihenfolge einer Website:
- Sprunglinks („Zum Hauptinhalt“)
- Hauptnavigation
- Suchfeld
- Hauptinhalt (Links und Buttons)
- Seitenleiste (falls vorhanden)
- Footer-Links
Häufige Probleme:
❌ Schlecht: Tab springt wild hin und her
❌ Schlecht: Wichtige Buttons werden übersprungen
❌ Schlecht: Tab bleibt in einem Bereich "gefangen"
❌ Schlecht: Unsichtbare Elemente sind fokussierbar
Testen der Tab-Reihenfolge:
- Browser öffnen, Maus wegpacken
- Tab-Taste drücken und durch die Seite navigieren
- Ist die Reihenfolge logisch?
- Erreichen Sie alle wichtigen Funktionen?
- Ist der Fokus immer sichtbar?
Fokus-Indikatoren richtig gestalten
Was ist ein Fokus-Indikator? Der sichtbare Rahmen oder die Hervorhebung, die zeigt, welches Element gerade fokussiert ist. Ohne ihn sind Tastaturnutzer „blind“.
Häufiger Designerfehler:
/* ❌ NIEMALS machen - entfernt Fokus-Indikatoren */
*:focus {
outline: none;
}
Bessere Fokus-Indikatoren:
/* ✅ Deutlicher, barrierefreier Fokus */
button:focus,
a:focus,
input:focus {
outline: 3px solid #005fcc;
outline-offset: 2px;
}
/* ✅ Alternative mit Box-Shadow */
.button:focus {
outline: none;
box-shadow: 0 0 0 3px rgba(0, 95, 204, 0.5);
}
WCAG-Anforderungen für Fokus:
- Mindestens 2px stark
- Kontrast 3:1 zum Hintergrund
- Auf allen fokussierbaren Elementen sichtbar
- Nicht durch andere Elemente verdeckt
Tastaturkürzel richtig implementieren
Das Problem: Viele Websites verwenden Tastenkürzel wie „s“ für Suche oder „m“ für Menü. Das kann Hilfstechnologien stören, die eigene Tastenkürzel verwenden.
WCAG 2.1 Regel: Einzelne Buchstaben als Tastenkürzel sind problematisch. Verwenden Sie Kombinationen wie Strg+S oder Alt+M.
Sichere Tastenkürzel:
✅ Strg + S für Speichern
✅ Alt + M für Menü
✅ Esc für Modal schließen
✅ Enter für Bestätigen
✅ Leertaste für Buttons aktivieren
Problematische Tastenkürzel:
❌ "s" für Suche (stört Screenreader)
❌ "m" für Menü (stört Sprachsteuerung)
❌ Beliebige Buchstaben ohne Modifier
Modale Dialoge (Popups) barrierefrei
Was sind modale Dialoge? Overlay-Fenster, die über den Hauptinhalt gelegt werden (Cookie-Banner, Login-Popups, Bestätigungsdialoge).
Das Accessibility-Problem: Der Fokus kann „hinter“ das Modal springen, Nutzer verlieren die Orientierung.
Lösung: Fokus-Management
- Modal öffnet: Fokus geht ins Modal
- Tab-Navigation: Bleibt im Modal gefangen
- Escape-Taste: Schließt das Modal
- Modal schließt: Fokus kehrt zum Auslöser zurück
Praktische Umsetzung:
// Modal öffnen
function openModal() {
const modal = document.getElementById('myModal');
// Modal anzeigen
modal.style.display = 'block';
modal.setAttribute('aria-hidden', 'false');
// Fokus auf erstes Element im Modal
const firstButton = modal.querySelector('button');
firstButton.focus();
// Hintergrund für Screenreader verstecken
document.getElementById('main-content').setAttribute('aria-hidden', 'true');
}
// Modal schließen
function closeModal() {
const modal = document.getElementById('myModal');
// Modal verstecken
modal.style.display = 'none';
modal.setAttribute('aria-hidden', 'true');
// Fokus zurück zum Auslöser
document.getElementById('open-modal-button').focus();
// Hintergrund wieder verfügbar
document.getElementById('main-content').removeAttribute('aria-hidden');
}
Dropdown-Menüs und Accordions
Dropdown-Menüs und Accordions (ein-/ausklappbare Bereiche) brauchen spezielle Tastatursteuerung.
Wichtige Tasten für Dropdowns:
- Enter/Leertaste: Öffnet/schließt Dropdown
- Pfeiltasten: Navigation in der Liste
- Escape: Schließt Dropdown
- Tab: Verlässt Dropdown
ARIA-Attribute für Zustandskommunikation:
<button aria-expanded="false" aria-haspopup="menu">
Kategorien
</button>
<ul role="menu" aria-hidden="true">
<li role="menuitem"><a href="/elektronik">Elektronik</a></li>
<li role="menuitem"><a href="/mode">Mode</a></li>
</ul>
aria-expanded="true/false"zeigt, ob Bereich geöffnet istaria-haspopup="menu"kündigt Dropdown anaria-hidden="true/false"versteckt/zeigt Inhalte für Screenreader
Testing und Qualitätssicherung
- Automatisierte Tools finden nur 30-40% aller Accessibility-Probleme
- Manuelle Tests mit Tastatur und Screenreader sind unverzichtbar
- User Testing mit Menschen mit Behinderungen liefert wertvollste Erkenntnisse
- Regelmäßige Kontrollen sind wichtiger als einmalige Audits
- Einfache Browser-Tools reichen für erste Prüfungen aus
Automatisierte Tools richtig einsetzen
Was können automatisierte Tools?
- Farbkontraste messen
- Fehlende Alt-Texte finden
- HTML-Strukturfehler aufdecken
- ARIA-Attribute validieren
- Formular-Labels prüfen
Was können sie NICHT?
- Sinnhaftigkeit von Alt-Texten bewerten
- Logik der Navigation prüfen
- Verständlichkeit von Texten beurteilen
- Benutzerfreundlichkeit messen
Die wichtigsten kostenlosen Testing-Tools
1. Browser-Entwicklertools (Chrome/Firefox) Wo: Rechtsklick → „Untersuchen“ → Accessibility-Tab Was sie zeigen:
- Accessibility Tree (wie Screenreader die Seite sehen)
- Farbkontraste mit sofortiger Pass/Fail-Bewertung
- ARIA-Attribute und ihre Werte
- Fokus-Reihenfolge visualisiert
Praxis-Tipp: Aktivieren Sie „Show user-agent shadow DOM“ um auch versteckte Elemente zu sehen.
2. WAVE Browser Extension (kostenlos) Installation: Browser-Store → „WAVE Evaluation Tool“ Was sie zeigt:
- Visuelle Markierungen direkt auf der Seite
- Fehler (rote Icons), Warnungen (gelbe Icons)
- Strukturelemente (grüne Icons)
- Detaillierte Erklärungen zu jedem Problem
Praxis-Tipp: Besonders gut für Einsteiger, da alles visuell markiert wird.
3. axe DevTools (kostenlos/Premium) Installation: Chrome Web Store → „axe DevTools“ Besonderheiten:
- Präziseste Regeln basierend auf WCAG
- Detaillierte Lösungsvorschläge
- Keine False Positives (falsche Alarme)
- Integration in Entwicklungs-Workflows möglich
Praxis-Tipp: Ideal für Entwickler und regelmäßige Tests.
Manuelle Tests Schritt für Schritt
Test 1: Nur-Tastatur-Navigation
- Maus wegpacken und nur Tab-Taste verwenden
- Komplette Website durchnavigieren
- Alle Links und Buttons erreichen?
- Formulare vollständig ausfüllbar?
- Modale Dialoge bedienbar?
- Fokus immer sichtbar?
Häufige Probleme beim Tastatur-Test:
- Dropdown-Menüs öffnen nur bei Mouse-Over
- Modale Dialoge nicht schließbar mit Escape
- Fokus „springt“ unlogisch hin und her
- Wichtige Buttons nicht erreichbar
- Carousel/Slider nicht bedienbar
Test 2: Screenreader-Simulation (NVDA – kostenlos)
- NVDA herunterladen (nvaccess.org)
- NVDA starten und Monitor ausschalten (!)
- Nur mit Gehör durch die Website navigieren
- Sind alle Inhalte verständlich?
- Funktioniert die Navigation?
Wichtige NVDA-Tasten für Tests:
H = Nächste Überschrift
1-6 = Überschriften der Ebene 1-6
K = Nächster Link
B = Nächster Button
F = Nächstes Formularfeld
T = Nächste Tabelle
NVDA+F7 = Alle Links anzeigen
Test 3: Zoom-Test (200% Vergrößerung)
- Browser-Zoom auf 200% (Strg + +)
- Sind alle Inhalte lesbar?
- Ist horizontales Scrollen nötig?
- Funktioniert die Navigation noch?
- Überlappen sich Elemente?
Häufige Probleme und schnelle Fixes
Problem: Bilder ohne Alt-Text Erkennung: Automatische Tools zeigen rote Markierungen Lösung: Alt-Attribute ergänzen oder alt=““ für dekorative Bilder
Problem: Zu geringe Farbkontraste Erkennung: Browser DevTools zeigen Kontrast-Warnungen Lösung: Textfarben dunkler machen oder Hintergrund heller
Problem: Fehlende Formular-Labels Erkennung: WAVE zeigt fehlende Labels als Fehler Lösung: <label for="feldname"> zu jedem Eingabefeld hinzufügen
Problem: Überschriften-Hierarchie durcheinander Erkennung: NVDA-Liste mit Überschriften (NVDA+F7) Lösung: H1→H2→H3 Reihenfolge korrigieren
Problem: Links mit unverständlichem Text Erkennung: Screenreader liest „hier klicken“ oder „mehr“ Lösung: Aussagekräftige Linktexte wie „Produktdetails anzeigen“
User Testing mit Menschen mit Behinderungen
Warum User Testing unverzichtbar ist: Auch die beste technische Umsetzung kann in der Praxis unbrauchbar sein, wenn echte Nutzer nicht damit zurechtkommen.
Wo finde ich Testteilnehmer?
- Lokale Behindertenverbände (Blinden- und Sehbehindertenverein, etc.)
- Selbsthilfegruppen und Betroffenenorganisationen
- Spezialisierte Agenturen für Accessibility-Testing
- Online-Plattformen wie UserTesting (mit Accessibility-Filter)
Was zahle ich für User Testing?
- Ehrenamtliche Tests: 50-100€ Aufwandsentschädigung
- Professionelle Tester: 80-150€ pro Stunde
- Agenturen: 2.000-5.000€ für komplette Studien
Typische Testaufgaben:
- Produkt finden und bestellen
- Account erstellen und einloggen
- Kontaktformular ausfüllen
- Terminbuchung durchführen
- Newsletter abonnieren
Kontinuierliches Monitoring statt einmaliger Audits
Das Problem: Websites ändern sich ständig. Ein einmaliges Audit hilft nur kurzfristig.
Lösung: Regelmäßige Mini-Tests
- Wöchentlich: Automatische Scans mit axe oder WAVE
- Monatlich: Manuelle Tastatur-Tests neuer Funktionen
- Quartalsweise: Vollständige Accessibility-Audits
- Bei größeren Updates: Sofortige Accessibility-Prüfung
Tools für kontinuierliches Monitoring:
- Lighthouse CI: Automatische Tests bei Code-Changes
- axe Monitor: Kommerzielle Überwachung der gesamten Website
- Siteimprove: All-in-One-Lösung mit Accessibility-Dashboard
Interne Prozesse etablieren:
- Accessibility-Champion im Team benennen
- Checklisten für häufige Aufgaben erstellen
- Schulungen für Content-Manager und Designer
- Review-Prozess vor Website-Updates
Rechtliche Absicherung und Compliance
- Die Erklärung zur Barrierefreiheit wird zur Pflichtangabe wie Impressum und Datenschutz
- Feedback-Mechanismen müssen Nutzern ermöglichen, Barrieren zu melden
- Dokumentation der Accessibility-Maßnahmen hilft bei Rechtsstreitigkeiten
- Regelmäßige Audits durch externe Experten stärken die Rechtsposition
- Proaktive Kommunikation zeigt guten Willen und reduziert Konfliktpotential
Die Erklärung zur Barrierefreiheit erstellen
Die Erklärung zur Barrierefreiheit ist ein öffentliches Dokument auf Ihrer Website, das den aktuellen Stand der Barrierefreiheit beschreibt – ähnlich wie Impressum oder Datenschutzerklärung.
Pflichtinhalte nach BFSG:
- Datum der Erstellung und letzten Aktualisierung
- Bewertung der Barrierefreiheit (welche Standards werden erfüllt)
- Bekannte Einschränkungen und deren Begründung
- Kontaktmöglichkeiten für Feedback zu Barrieren
- Verbesserungsmaßnahmen und Zeitpläne
Praktisches Beispiel einer Erklärung:
Erklärung zur Barrierefreiheit
Diese Erklärung gilt für die Website www.beispiel-shop.de der
Beispiel GmbH, Musterstraße 123, 12345 Musterstadt.
Stand der Barrierefreiheit:
Unsere Website entspricht den Web Content Accessibility Guidelines
(WCAG) 2.1 auf Konformitätsstufe AA. Diese Bewertung basiert auf
einer externen Prüfung vom 15.03.2025.
Bekannte Einschränkungen:
- Videos in unserem Blog haben noch keine Untertitel
(Behebung bis 30.06.2025 geplant)
- Das Produktkonfigurator-Tool ist nur eingeschränkt
mit Screenreadern nutzbar (Alternative: Telefonberatung)
Feedback und Kontakt:
Falls Sie Barrieren auf unserer Website feststellen,
kontaktieren Sie uns:
E-Mail: barrierefreiheit@beispiel-shop.de
Telefon: 0123-456789
Postadresse: siehe Impressum
Wir antworten innerhalb von 5 Werktagen und bemühen uns
um schnelle Lösungen.
Durchsetzungsverfahren:
Bei unzureichender Antwort können Sie sich an die
Marktüberwachungsbehörde Ihres Bundeslandes wenden.
Letzte Aktualisierung: 28.06.2025
Feedback-Mechanismen einrichten
Warum Feedback wichtig ist: Menschen mit Behinderungen sind die besten Tester Ihrer Website. Sie finden Probleme, die in keinem automatischen Test auftauchen.
Einfache Feedback-Kanäle schaffen:
- Dedizierte E-Mail-Adresse: barrierefreiheit@firma.de
- Kontaktformular mit Kategorie „Barrierefreiheit“
- Telefon-Hotline für Menschen, die nicht schreiben können
- Feedback-Button auf jeder Seite
Gute Feedback-Kommunikation:
❌ Schlecht: "Vielen Dank für Ihr Feedback. Wir prüfen das."
✅ Besser: "Vielen Dank für den Hinweis auf das Problem mit
dem Checkout-Button. Wir haben es reproduzieren können und
arbeiten an einer Lösung. Sie können erwarten, dass das
Problem bis zum 15.07.2025 behoben ist. Wir melden uns
bei Ihnen, sobald die Korrektur online ist."
Dokumentation für den Ernstfall
Was sollten Sie dokumentieren?
- Accessibility-Audits und deren Ergebnisse
- Behobene Probleme mit Datum und Methode
- Schulungsmaßnahmen für Mitarbeiter
- User Testing mit Menschen mit Behinderungen
- Investitionen in Barrierefreiheit (Zeit, Geld, Tools)
Warum Dokumentation wichtig ist:
- Nachweis des guten Willens bei Rechtsstreitigkeiten
- Continuous Improvement zeigt Fortschritte auf
- Interne Prozesse werden transparent und wiederholbar
- Compliance-Nachweis für Geschäftspartner
Externe Audits und Zertifizierungen
Wann externe Audits sinnvoll sind:
- Vor dem BFSG-Stichtag für Rechtssicherheit
- Nach größeren Relaunches oder Funktionserweiterungen
- Bei kritischen Geschäftsprozessen (Online-Banking, E-Commerce)
- Für Zertifizierungen und Ausschreibungen
Was kostet ein professionelles Audit?
- Kleinere Websites (bis 20 Seiten): 2.000-5.000€
- Mittlere Websites (bis 100 Seiten): 5.000-15.000€
- Große Portale (über 100 Seiten): 15.000-50.000€
- Laufende Betreuung: 500-2.000€ pro Monat
Anerkannte Prüfstellen in Deutschland:
- BIK BITV-Test: Zertifizierung nach deutscher BITV
- IAAP-zertifizierte Prüfer: International anerkannte Experten
- TÜV und Dekra: Bieten Accessibility-Audits an
- Spezialisierte Agenturen: Eye-Able, Siteimprove, 2Sicht
Versicherungsschutz und Risikomanagement
Rechtsschutzversicherung prüfen: Viele Betriebsrechtsschutz-Versicherungen decken Abmahnungen wegen Accessibility-Verstößen ab. Prüfen Sie Ihren Vertrag oder fragen Sie nach.
D&O-Versicherung für Geschäftsführer: Bei schwerwiegenden BFSG-Verstößen können persönliche Haftungsrisiken für Geschäftsführer entstehen. D&O-Versicherungen (Directors & Officers) decken solche Risiken ab.
Präventive Maßnahmen:
- Accessibility-Klauseln in Webentwicklungsverträgen
- Haftungsausschluss für Drittanbieter-Content (YouTube, Social Media)
- Regelmäßige Rechtslage-Updates durch Fachanwälte
- Branchenverbände für aktuelle Rechtsentwicklungen
Kosten, Nutzen und Business Case
- Barrierefreiheit von Anfang an kostet 1-3% Mehraufwand
- Nachträgliche Anpassungen können 15-25% der ursprünglichen Entwicklungskosten erreichen
- Die Zielgruppe umfasst weit mehr als nur Menschen mit Behinderungen
- SEO-Vorteile und bessere Usability steigern Conversion-Rates
- Rechtliche Compliance-Kosten sind oft geringer als Bußgeld-Risiken
Realistische Kostenplanung
Was kostet Barrierefreiheit wirklich?
Neuentwicklung (Accessibility von Anfang an):
- Kleine Website (bis 10 Seiten): +500-1.500€
- Mittlere Website (bis 50 Seiten): +2.000-8.000€
- Großer Online-Shop: +10.000-30.000€
- Enterprise-Portal: +50.000-150.000€
Nachträgliche Anpassung bestehender Websites:
- Grundlegende Fixes (Alt-Texte, Kontraste): 2.000-5.000€
- Strukturelle Änderungen (Navigation, Formulare): 5.000-15.000€
- Komplette Überarbeitung: 50-80% der ursprünglichen Entwicklungskosten
Laufende Kosten:
- Content-Schulungen: 1.000-3.000€ pro Jahr
- Monitoring-Tools: 500-2.000€ pro Jahr
- Externe Audits: 3.000-10.000€ alle 2 Jahre
Die erweiterte Zielgruppe verstehen
Barrierefreiheit hilft mehr Menschen als oft gedacht:
Direkt Betroffene (ca. 10% der Bevölkerung):
- 7,9 Millionen Schwerbehinderte in Deutschland
- 1,2 Millionen Blinde und Sehbehinderte
- 16 Millionen Hörgeschädigte
- Millionen mit motorischen Einschränkungen
Situativ Profitierenden (ca. 20% zusätzlich):
- Ältere Menschen mit nachlassenden Fähigkeiten
- Temporär Eingeschränkte (gebrochener Arm, Augen-OP)
- Eltern mit Kleinkind (eine Hand nicht frei)
- Nutzer in lauter Umgebung (profitieren von Untertiteln)
- Menschen bei hellem Sonnenlicht (brauchen starke Kontraste)
Internationale Nutzer:
- Nicht-Muttersprachler profitieren von einfacher Sprache
- Menschen mit geringer Digitalkompetenz
- Nutzer mit langsamen Internetverbindungen
Messbare Business-Vorteile
SEO-Verbesserungen durch Accessibility:
- Semantisches HTML verbessert Suchmaschinen-Verständnis
- Alt-Texte werden von Google für Bildersuche verwendet
- Klare Überschriftenstruktur hilft beim Ranking
- Schnellere Ladezeiten durch cleanen Code
- Bessere User Experience reduziert Bounce-Rate
Conversion-Rate-Steigerungen:
- Klarere Navigation führt zu weniger Abbrüchen
- Bessere Formulare reduzieren Eingabefehler
- Verständlichere Texte überzeugen mehr Kunden
- Größere Touch-Targets verbessern Mobile-Experience
Reale Zahlen aus Studien:
- Target.com: 13% Umsatzsteigerung nach Accessibility-Verbesserungen
- Legal & General: 51% mehr Policen-Abschlüsse online
- Virgin Atlantic: 200% mehr Buchungen von Menschen mit Behinderungen
Return on Investment (ROI) berechnen
Beispielrechnung für einen Online-Shop:
Investition in Barrierefreiheit:
Initiale Umsetzung: 15.000€
Jährliche Maintenance: 3.000€
Externes Audit (alle 2 Jahre): 5.000€
Gesamtkosten über 3 Jahre: 29.000€
Messbare Einsparungen:
Vermiedene Bußgelder: 0-100.000€ (Risiko)
Vermiedene Abmahnkosten: 0-20.000€ (Risiko)
Reduzierte Support-Anfragen: 2.000€/Jahr
SEO-Verbesserungen: 5.000€/Jahr Werbewert
Zusätzliche Umsätze:
10% der Behinderten als neue Kunden: +50 Kunden/Jahr
Ø Warenkorbwert 150€: +7.500€ Umsatz/Jahr
Verbesserte Conversion (+0,5%): +15.000€ Umsatz/Jahr
Gesamt: +22.500€ Umsatz/Jahr
ROI-Berechnung:
Zusatzumsatz 3 Jahre: 67.500€
Abzgl. Investition: -29.000€
Nettogewinn: 38.500€
ROI: 133% über 3 Jahre
Fördermöglichkeiten und Steuervorteile
Staatliche Förderungen:
- KfW-Förderkredite für Digitalisierung (oft auch Accessibility)
- Bundesförderung Digitalisierung für KMU
- Länderspezifische Programme (Bayern: Digitalbonus, NRW: Digital-Bonus)
Steuerliche Absetzbarkeit:
- Betriebsausgaben: Alle Accessibility-Kosten voll absetzbar
- Investitionsabzugsbetrag: Bei größeren IT-Projekten möglich
- Sonderabschreibungen: Für Digitalisierungsmaßnahmen
CSR und Marketing-Vorteile:
- Positive Presseberichterstattung über Inklusions-Engagement
- Arbeitgeberattraktivität steigt bei jüngeren Bewerbern
- B2B-Vorteile bei Ausschreibungen (Accessibility oft Bewertungskriterium)
- Versicherungsrabatte bei einigen Cyber-Versicherungen
Zukunftsperspektiven und Weiterentwicklung
- WCAG 3.0 wird voraussichtlich ein neues Bronze/Silber/Gold-Bewertungsmodell einführen
- KI-Tools verbessern automatische Alt-Text-Generierung und Accessibility-Testing
- Voice User Interfaces und AR/VR schaffen neue Accessibility-Herausforderungen
- Internationale Harmonisierung vereinfacht globale Compliance
- Personalisierung durch Machine Learning ermöglicht individuelle Anpassungen
WCAG 3.0: Was kommt auf uns zu?
Die nächste Generation der Accessibility-Standards befindet sich in Entwicklung und wird grundlegende Änderungen bringen:
Neues Bewertungsmodell: Statt der bisherigen A/AA/AAA-Stufen wird es voraussichtlich Bronze/Silber/Gold geben mit einem Punktesystem. Das ermöglicht differenziertere Bewertungen und belohnt Verbesserungen jenseits der Mindeststandards.
Erweiterte Zielgruppen: WCAG 3.0 adressiert kognitive Behinderungen und mentale Gesundheit stärker als die Vorgängerversion. Themen wie Aufmerksamkeitsdefizite, Lernbehinderungen und Angststörungen fließen in die Richtlinien ein.
Neue Technologien: Voice User Interfaces, Augmented Reality und Virtual Reality werden eigene Accessibility-Kriterien erhalten. Das betrifft auch Sprachassistenten und Chatbots.
Zeitplan und Auswirkungen:
- 2025-2026: Erste stabile Entwürfe erwartet
- 2027-2028: Veröffentlichung als W3C Recommendation
- 2029-2030: Integration in nationale Gesetze
Was sollten Sie jetzt tun? Konzentrieren Sie sich auf WCAG 2.1 Level AA – diese Kenntnisse bleiben relevant. WCAG 3.0 wird darauf aufbauen, nicht alles ersetzen.
Künstliche Intelligenz in der Accessibility
Automatische Alt-Text-Generierung: KI-Tools werden immer besser darin, Bilder zu beschreiben:
- Microsoft Cognitive Services: Generiert Alt-Texte für CMS
- Google Cloud Vision: Erkennt Text in Bildern automatisch
- ChatGPT/GPT-4: Erstellt kontextbezogene Bildbeschreibungen
Grenzen der KI: KI kann faktische Beschreibungen liefern, aber Kontext und Relevanz bleiben menschliche Aufgaben. „Rotes Auto vor Haus“ ist technisch korrekt, aber „Ferrari 488 GTB vor unserem Firmengebäude“ ist für einen Autohändler relevanter.
AI-powered Accessibility Testing:
- Intelligente Fehlererkennung: KI findet Probleme, die regelbasierte Tools übersehen
- Prioritätsbewertung: Automatische Einschätzung, welche Probleme zuerst gelöst werden sollten
- Lösungsvorschläge: KI generiert konkrete Code-Fixes
Personalisierung und Adaptive Interfaces: Zukünftige Websites könnten sich automatisch an Nutzerbedürfnisse anpassen:
- Automatische Kontrastanpassung basierend auf Sehfähigkeiten
- Vereinfachte Navigation für kognitive Einschränkungen
- Sprachgeschwindigkeit an individuelle Präferenzen angepasst
Voice User Interfaces und Conversational AI
Neue Chancen für Accessibility: Sprachsteuerung kann für Menschen mit motorischen Einschränkungen revolutionär sein. Statt mühsamer Tastatureingabe reicht ein gesprochenes „Bestelle das rote T-Shirt in Größe M“.
Neue Herausforderungen:
- Sprachbehinderungen: Wie erreichen wir Menschen, die nicht sprechen können?
- Lärmige Umgebung: Voice-Only-Interfaces funktionieren nicht überall
- Privatsphäre: Nicht jeder möchte laut mit seinem Computer sprechen
Multimodale Lösungen: Die Zukunft liegt in mehreren parallelen Eingabemethoden:
- Sprache für schnelle Befehle
- Touch/Tastatur für präzise Eingaben
- Blickverfolgung für Menschen mit Lähmungen
- Gestensteuerung für spezielle Anwendungen
Internationale Entwicklungen
EU-weite Harmonisierung: Der European Accessibility Act schafft einheitliche Standards in allen EU-Ländern. Das vereinfacht internationale Geschäfte erheblich – eine Website, die deutschen BFSG-Standards entspricht, funktioniert auch in Frankreich oder Italien.
Global Player setzen Standards:
- Apple integriert Accessibility tief in alle Produkte
- Google macht Android accessibility-first
- Microsoft investiert Milliarden in inclusive Design
- Diese De-facto-Standards beeinflussen alle anderen
Emerging Markets: Länder wie Indien, Brasilien und Nigeria entwickeln eigene Accessibility-Gesetze. Wer global agiert, sollte diese Entwicklungen im Blick behalten.
Praktische Vorbereitung auf die Zukunft
1. Flexible Grundlagen schaffen
- Semantisches HTML bleibt die Basis aller Accessibility
- Progressive Enhancement macht Websites zukunftssicher
- Design Systems erleichtern konsistente Accessibility
2. Team-Kompetenzen ausbauen
- Accessibility-Schulungen für alle Beteiligten
- Inclusive Design als Standard-Prozess etablieren
- User Testing mit Menschen mit Behinderungen regelmäßig durchführen
3. Technologie-Trends verfolgen
- WCAG 3.0 Working Drafts beobachten
- AI-Tools für Accessibility testen
- Voice Interface Guidelines studieren
- AR/VR Accessibility experimentell erkunden
4. Community und Netzwerk nutzen
- Konferenzen wie die „Accessibility Club Meetups“ besuchen
- Online-Communities auf Twitter (#a11y) und LinkedIn folgen
- W3C Mailinglisten abonnieren für erste Informationen
- Erfahrungsaustausch mit anderen Unternehmen suchen
Die Zukunft der Web-Accessibility wird spannend und herausfordernd. Wer heute solide Grundlagen schafft und flexibel bleibt, wird auch zukünftige Anforderungen erfolgreich meistern. Barrierefreiheit ist kein Projekt mit Enddatum – es ist eine dauerhafte Verpflichtung zu besserem Design für alle Menschen.
Quellen
[1] Statistisches Bundesamt (2023): „Schwerbehinderte Menschen in Deutschland“, https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Gesundheit/Behinderte-Menschen/_inhalt.html
[2] BFSG-Gesetz.de (2024): „Barrierefreiheitsstärkungsgesetz Übersicht“, https://bfsg-gesetz.de/
[3] W3C Web Accessibility Initiative (2023): „Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1“, https://www.w3.org/TR/WCAG21/
[4] Bundesfachstelle Barrierefreiheit (2024): „Das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz“, https://www.bundesfachstelle-barrierefreiheit.de/DE/Fachwissen/Produkte-und-Dienstleistungen/Barrierefreiheitsstaerkungsgesetz/barrierefreiheitsstaerkungsgesetz_node.html
[5] Bundesministerium für Arbeit und Soziales (2021): „Barrierefreiheitsstärkungsgesetz“, https://www.bmas.de/DE/Service/Gesetze-und-Gesetzesvorhaben/barrierefreiheitsstaerkungsgesetz.html